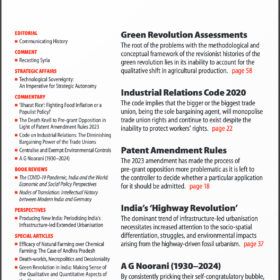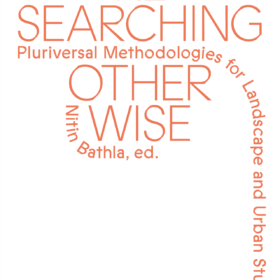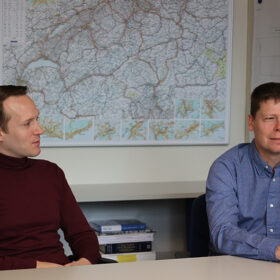Seit einem Jahrhundert prägen Autobahnen Städte, Wirtschaftsräume und nationale Identitäten. Doch im November 2024 lehnten die Schweizer Stimmbürger:innen eine Autobahnerweiterung im Wert von fünf Milliarden Franken ab – ein deutliches Signal gegen eine infrastrukturgetriebene Urbanisierung. Während weltweit weiterhin auf autobahnbasiertes Wachstum gesetzt wird, lädt das Schweizer Moratorium dazu ein, Mobilität, territoriale Organisation und ökologische Zukunft jenseits des Autobahn-Urbanismus neu zu denken.
Ein historischer Richtungswechsel
In einer historischen Volksabstimmung im November 2024 lehnte die Schweizer Bevölkerung das Bundesgesetz von 2023 zur Erweiterung des Nationalstrassennetzes – ein Investitionspaket von fünf Milliarden Franken – ab. Während dieses Moratorium im Inland öffentliche Gelder in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und nachhaltiger Mobilitätsalternativen umleitet, liegt seine wahre Bedeutung, die bisher unterschätzt wurde, auf internationaler Ebene.
In einer Welt, die von erstarkenden populistischen Machthabern und ihrer Infrastrukturpolitik geprägt ist, bietet diese demokratische Abkehr von der infrastrukturgetriebenen Urbanisierung eine neue Perspektive. Sie eröffnet die Möglichkeit, sozial-ökologische Alternativen zu einem Autobahn-Urbanismus zu erkunden, der auf Ressourcenverschleiss setzt.
Autobahn-Urbanismus treibt den Bauwahn an
Das Modell des Autobahn-Urbanismus hat sich über das letzte Jahrhundert entwickelt und in den letzten Jahren – insbesondere im Globalen Süden und Osten – als wachstumsorientierte Strategie verstärkt durchgesetzt. Der aktuelle Autobahnboom zeigt sich etwa in Chinas Belt and Road Initiative, die den rasanten Ausbau in europäischen Randgebieten wie Montenegro vorantreibt, Indiens Bharatmala-Programm, das fruchtbare Agrarland in Tausende Kilometer Autobahn verwandelt, und der wachsenden Marmara-Autobahn in der Türkei.
Obwohl diese Programme weltweit auf erheblichen sozialen Widerstand stossen, setzt das bindende Schweizer Moratorium ein klares Zeichen. Besonders bemerkenswert ist, dass es ausgerechnet in einem Land erlassen wurde, das die höchste Autobahndichte aufweist und als ideologische Geburtsstätte dieses Modells gilt. Nur wenige wissen, dass der Gestalter der modernen Autobahn, Piero Puricelli, Anfang des 20. Jahrhunderts als Ingenieur an der ETH Zürich ausgebildet wurde. Seine Autostrada dei Laghi (heute die A8), die Mailand mit dem Comer See verband, prägte 1924 das Verhältnis zwischen Urbanisierung, einer national-romantischen Landschaft und dem Staat als räumliche Erfahrung. Dieses Konzept beeinflusste später Autobahnprogramme weltweit.
Was steht auf dem Spiel
Wer heute auf den Nationalstrassen – errichtet während des Wirtschaftsbooms der 1960er-Jahre – fährt, durchquert romantisierte Naturschutzgebiete und erlebt ein Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit, das sich über städtische und regionale Grenzen hinweg erstreckt. Diese Erfahrung der ausgedehnten Urbanisierung wird eindrucksvoll im Schweizer Film Reisende Krieger (1981) dargestellt, wie Christian Schmid beschreibt.
Was also mit dem Ende des Autobahn-Urbanismus auf dem Spiel steht, ist nicht nur seine ökologische Konsequenz – der enorme Material- und Energieverbrauch –, sondern auch die Zukunft von «Natur» mit grossem N und der nationalen Raumordnung, die durch ihn geformt wurde.
 Dr. Nitin Bathla is a Zurich-based scholar and practitioner working at the intersection of urbanisation, the environment, and society, bridging the disciplines of urban studies, ecology, geography, and sociology. He is the author of the award-winning book Researching Otherwise: Pluriversal Methodologies in Landscape and Urban Studies and the critically acclaimed documentary film Not Just Roads. His transdisciplinary and pluriversal research approaches actively combine academic inquiry with artistic practices such as filmmaking and socially engaged art.
Dr. Nitin Bathla is a Zurich-based scholar and practitioner working at the intersection of urbanisation, the environment, and society, bridging the disciplines of urban studies, ecology, geography, and sociology. He is the author of the award-winning book Researching Otherwise: Pluriversal Methodologies in Landscape and Urban Studies and the critically acclaimed documentary film Not Just Roads. His transdisciplinary and pluriversal research approaches actively combine academic inquiry with artistic practices such as filmmaking and socially engaged art.